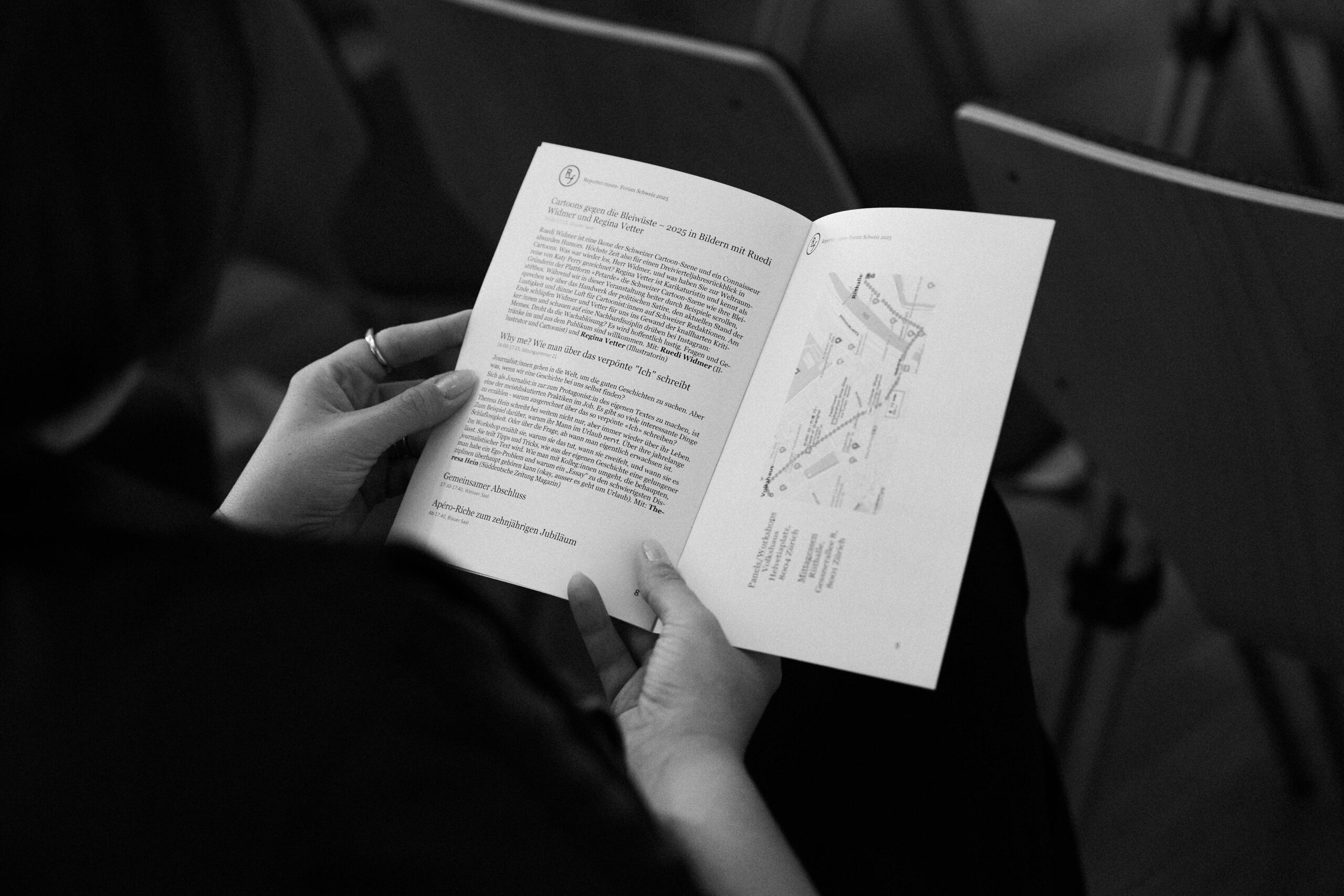Reporter:innen-Forum Schweiz 2025
12. September 2025 - Volkshaus Zürich
Reporter:innen-Forum Schweiz 2025
12. September 2025 - Volkshaus Zürich
Reporter:innen-Forum Schweiz 2025
12. September 2025 - Volkshaus Zürich
Reporter:innen-Forum Schweiz 2025
12. September 2025 -
Volkshaus Zürich
Das Programm
Das Programm
Lightning-Talk mit Yves Kilchör
Lightning-Talk mit Yves Kilchör
Lightning-Talk mit Joël Widmer
Lightning-Talk mit Yves Kilchör
Yves Kilchör ist seit Kind an Radiomacher aus Leidenschaft. Er ist seit 2022 Produzent, Redaktor und Host bei Radio SRF 4 News und war zuvor rund zehn Jahre Redaktor und Moderator bei RadioFr. Freiburg. Davor füllte er seinen Rucksack mit einer Portion Journalismus- und Kommunikationsstudium an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, einem harten Stück Berufsmaturität und legte für all dies die Basis mit einer kaufmännischen Grundausbildung bei der Bundesverwaltung. Yves Kilchör ist Mitgründer von Blind Power, das Audiodeskriptionen anbietet, zum Beispiel von Fussballmatches. Er befasst sich mit der inklusiven Berichterstattung und unterrichtet am MAZ «Inklusiv am Sender». Dabei ist Yves Kilchör als Person mit Sehbehinderung wichtig, dass Menschen mit einer Behinderung uneingeschränkten Zugang zu Medien haben und in diesem Bereich arbeiten können. Die Vielfalt in Medienunternehmen macht den positiven Unterschied.
Yves Kilchör ist seit Kind an Radiomacher aus Leidenschaft. Er ist seit 2022 Produzent, Redaktor und Host bei Radio SRF 4 News und war zuvor rund zehn Jahre Redaktor und Moderator bei RadioFr. Freiburg. Davor füllte er seinen Rucksack mit einer Portion Journalismus- und Kommunikationsstudium an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, einem harten Stück Berufsmaturität und legte für all dies die Basis mit einer kaufmännischen Grundausbildung bei der Bundesverwaltung. Yves Kilchör ist Mitgründer von Blind Power, das Audiodeskriptionen anbietet, zum Beispiel von Fussballmatches. Er befasst sich mit der inklusiven Berichterstattung und unterrichtet am MAZ «Inklusiv am Sender». Dabei ist Yves Kilchör als Person mit Sehbehinderung wichtig, dass Menschen mit einer Behinderung uneingeschränkten Zugang zu Medien haben und in diesem Bereich arbeiten können. Die Vielfalt in Medienunternehmen macht den positiven Unterschied.
Yves Kilchör ist seit Kind an Radiomacher aus Leidenschaft. Er ist seit 2022 Produzent, Redaktor und Host bei Radio SRF 4 News und war zuvor rund zehn Jahre Redaktor und Moderator bei RadioFr. Freiburg. Davor füllte er seinen Rucksack mit einer Portion Journalismus- und Kommunikationsstudium an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, einem harten Stück Berufsmaturität und legte für all dies die Basis mit einer kaufmännischen Grundausbildung bei der Bundesverwaltung. Yves Kilchör ist Mitgründer von Blind Power, das Audiodeskriptionen anbietet, zum Beispiel von Fussballmatches. Er befasst sich mit der inklusiven Berichterstattung und unterrichtet am MAZ «Inklusiv am Sender». Dabei ist Yves Kilchör als Person mit Sehbehinderung wichtig, dass Menschen mit einer Behinderung uneingeschränkten Zugang zu Medien haben und in diesem Bereich arbeiten können. Die Vielfalt in Medienunternehmen macht den positiven Unterschied.
.
.
.
.
Vom Manipulieren der Wirklichkeit – Rezepte gegen Fake News
Das Weisse Haus sperrte einen AP-Reporter aus, weil die Nachrichtenagentur sich geweigert hatte, den Golf von Mexiko faktenwidrig «Golf von Amerika» zu nennen. Russlands Machthaber Wladimir Putin behauptet, die Ukraine sei selbst schuld am russischen Angriffskrieg. Und auch in der Schweiz nimmt die Propaganda unterschiedlicher politischer Akteur:innen zu.
Was ist wahr, was gelogen? Wer verbreitet Fake News, wie werden die Dinge ins Gegenteil verkehrt? Wo liegen die Grenzen zwischen Journalismus, PR und Propaganda? Wie gehen wir Journalist:innen damit um, was kann der Staat tun und wo wird er selbst zum Problem?
Mit: Sylvia Sasse (Uni Zürich) und Georg Häsler (NZZ)
Moderation: Kaspar Surber (WOZ)
Vom Manipulieren der Wirklichkeit – Rezepte gegen Fake News
Das Weisse Haus sperrte einen AP-Reporter aus, weil die Nachrichtenagentur sich geweigert hatte, den Golf von Mexiko faktenwidrig «Golf von Amerika» zu nennen. Russlands Machthaber Wladimir Putin behauptet, die Ukraine sei selbst schuld am russischen Angriffskrieg. Und auch in der Schweiz nimmt die Propaganda unterschiedlicher politischer Akteur:innen zu.
Was ist wahr, was gelogen? Wer verbreitet Fake News, wie werden die Dinge ins Gegenteil verkehrt? Wo liegen die Grenzen zwischen Journalismus, PR und Propaganda? Wie gehen wir Journalist:innen damit um, was kann der Staat tun und wo wird er selbst zum Problem?
Mit: Sylvia Sasse (Uni Zürich) und Georg Häsler (NZZ)
Moderation: Kaspar Surber (WOZ)
Vom Manipulieren der Wirklichkeit – Rezepte gegen Fake News
Das Weisse Haus sperrte einen AP-Reporter aus, weil die Nachrichtenagentur sich geweigert hatte, den Golf von Mexiko faktenwidrig «Golf von Amerika» zu nennen. Russlands Machthaber Wladimir Putin behauptet, die Ukraine sei selbst schuld am russischen Angriffskrieg. Und auch in der Schweiz nimmt die Propaganda unterschiedlicher politischer Akteur:innen zu.
Was ist wahr, was gelogen? Wer verbreitet Fake News, wie werden die Dinge ins Gegenteil verkehrt? Wo liegen die Grenzen zwischen Journalismus, PR und Propaganda? Wie gehen wir Journalist:innen damit um, was kann der Staat tun und wo wird er selbst zum Problem?
Mit: Sylvia Sasse (Uni Zürich) und Georg Häsler (NZZ)
Moderation: Kaspar Surber (WOZ)
Vom Manipulieren der Wirklichkeit – Rezepte gegen Fake News
Das Weisse Haus sperrte einen AP-Reporter aus, weil die Nachrichtenagentur sich geweigert hatte, den Golf von Mexiko faktenwidrig «Golf von Amerika» zu nennen. Russlands Machthaber Wladimir Putin behauptet, die Ukraine sei selbst schuld am russischen Angriffskrieg. Und auch in der Schweiz nimmt die Propaganda unterschiedlicher politischer Akteur:innen zu.
Was ist wahr, was gelogen? Wer verbreitet Fake News, wie werden die Dinge ins Gegenteil verkehrt? Wo liegen die Grenzen zwischen Journalismus, PR und Propaganda? Wie gehen wir Journalist:innen damit um, was kann der Staat tun und wo wird er selbst zum Problem?
Mit: Sylvia Sasse (Uni Zürich) und Georg Häsler (NZZ)
Moderation: Kaspar Surber (WOZ)
Vom Manipulieren der Wirklichkeit – Rezepte gegen Fake News
Das Weisse Haus sperrte einen AP-Reporter aus, weil die Nachrichtenagentur sich geweigert hatte, den Golf von Mexiko faktenwidrig «Golf von Amerika» zu nennen. Russlands Machthaber Wladimir Putin behauptet, die Ukraine sei selbst schuld am russischen Angriffskrieg. Und auch in der Schweiz nimmt die Propaganda unterschiedlicher politischer Akteur:innen zu.
Was ist wahr, was gelogen? Wer verbreitet Fake News, wie werden die Dinge ins Gegenteil verkehrt? Wo liegen die Grenzen zwischen Journalismus, PR und Propaganda? Wie gehen wir Journalist:innen damit um, was kann der Staat tun und wo wird er selbst zum Problem?
Mit: Sylvia Sasse (Uni Zürich) und Georg Häsler (NZZ)
Moderation: Kaspar Surber (WOZ)
Kritisch berichten von der Seitenlinie
Den Berichterstatter:innen auf den Pressetribünen wird nachgesagt, sie seien Fans jener Sportklubs, die unten auf dem Spielfeld um Titel kämpfen. Wie gelingt es als Journalist:in, trotz Leidenschaft für eine Sportart oder den Klub aus der eigenen Stadt kritisch zu bleiben? Und wie macht man Sportjournalismus, der über den einfachen Matchbericht hinausgeht, den bald die KI für uns schreibt? Wir diskutieren über Nähe und Distanz – im Sportjournalismus ein Dauerbrenner.
Mit: Céline Feller (Leiterin Sport, bz Basel) und Klaus Zaugg (Sportjournalist)
Moderation: Yann Schlegel (bz Basel)
Kritisch berichten von der Seitenlinie
Den Berichterstatter:innen auf den Pressetribünen wird nachgesagt, sie seien Fans jener Sportklubs, die unten auf dem Spielfeld um Titel kämpfen. Wie gelingt es als Journalist:in, trotz Leidenschaft für eine Sportart oder den Klub aus der eigenen Stadt kritisch zu bleiben? Und wie macht man Sportjournalismus, der über den einfachen Matchbericht hinausgeht, den bald die KI für uns schreibt? Wir diskutieren über Nähe und Distanz – im Sportjournalismus ein Dauerbrenner.
Mit: Céline Feller (Leiterin Sport, bz Basel) und Klaus Zaugg (Sportjournalist)
Moderation: Yann Schlegel (bz Basel)
Kritisch berichten von der Seitenlinie
Den Berichterstatter:innen auf den Pressetribünen wird nachgesagt, sie seien Fans jener Sportklubs, die unten auf dem Spielfeld um Titel kämpfen. Wie gelingt es als Journalist:in, trotz Leidenschaft für eine Sportart oder den Klub aus der eigenen Stadt kritisch zu bleiben? Und wie macht man Sportjournalismus, der über den einfachen Matchbericht hinausgeht, den bald die KI für uns schreibt? Wir diskutieren über Nähe und Distanz – im Sportjournalismus ein Dauerbrenner.
Mit: Céline Feller (Leiterin Sport, bz Basel) und Klaus Zaugg (Sportjournalist)
Moderation: Yann Schlegel (bz Basel)
Kritisch berichten von der Seitenlinie
Den Berichterstatter:innen auf den Pressetribünen wird nachgesagt, sie seien Fans jener Sportklubs, die unten auf dem Spielfeld um Titel kämpfen. Wie gelingt es als Journalist:in, trotz Leidenschaft für eine Sportart oder den Klub aus der eigenen Stadt kritisch zu bleiben? Und wie macht man Sportjournalismus, der über den einfachen Matchbericht hinausgeht, den bald die KI für uns schreibt? Wir diskutieren über Nähe und Distanz – im Sportjournalismus ein Dauerbrenner.
Mit: Céline Feller (Leiterin Sport, bz Basel) und Klaus Zaugg (Sportjournalist)
Moderation: Yann Schlegel (bz Basel)
Kritisch berichten von der Seitenlinie
Den Berichterstatter:innen auf den Pressetribünen wird nachgesagt, sie seien Fans jener Sportklubs, die unten auf dem Spielfeld um Titel kämpfen. Wie gelingt es als Journalist:in, trotz Leidenschaft für eine Sportart oder den Klub aus der eigenen Stadt kritisch zu bleiben? Und wie macht man Sportjournalismus, der über den einfachen Matchbericht hinausgeht, den bald die KI für uns schreibt? Wir diskutieren über Nähe und Distanz – im Sportjournalismus ein Dauerbrenner.
Mit: Céline Feller (Leiterin Sport, bz Basel) und Klaus Zaugg (Sportjournalist)
Moderation: Yann Schlegel (bz Basel)
.
.
.
.
.
Wir wissen wo dein Auto steht
Der Hack beim VW-Konzern wäre auch gelangweilten Teenagern gelungen. So beschreibt Hacker Flüpke (Chaos Computer Club Berlin), wie er und sein Team an die Bewegungsdaten von 800'000 Autos des VW-Konzerns gelangt sind.
In einer vielbeachteten Recherche für den Spiegel konnte Flüpke zusammen mit Co-Autor:innen damit Brisantes zeigen. So verrieten die Daten etwa, wer beim Bundesnachrichtendienst arbeitet, wer im Berliner Grossbordell Artemis ein- und ausgeht. Oder welche Personen zum Militärflugplatz der United States Air Force in Ramstein fahren. Sogar Bewegungen von Fahrzeugen in der Ukraine und Israel waren nachvollziehbar.
Wir diskutieren die Fragen, wo man im Internet über 9 Terrabyte hochsensibler Daten stolpert, und wie es gelingt, aus einer Datenwolke eine gesellschaftlich relevante Geschichte zu machen, und welche ethischen Fragen sich dabei auftun. Und wie arbeiten IT-Experten:innen und Journalist:innen zusammen? Wo liegen die Schwierigkeiten und wo das Potential?
Mit: Carl Fabian Lüpke (White-Hat-Hacker)
Moderation: Michael Scheurer (freischaffend)
Wir wissen wo dein Auto steht
Der Hack beim VW-Konzern wäre auch gelangweilten Teenagern gelungen. So beschreibt Hacker Flüpke (Chaos Computer Club Berlin), wie er und sein Team an die Bewegungsdaten von 800'000 Autos des VW-Konzerns gelangt sind.
In einer vielbeachteten Recherche für den Spiegel konnte Flüpke zusammen mit Co-Autor:innen damit Brisantes zeigen. So verrieten die Daten etwa, wer beim Bundesnachrichtendienst arbeitet, wer im Berliner Grossbordell Artemis ein- und ausgeht. Oder welche Personen zum Militärflugplatz der United States Air Force in Ramstein fahren. Sogar Bewegungen von Fahrzeugen in der Ukraine und Israel waren nachvollziehbar.
Wir diskutieren die Fragen, wo man im Internet über 9 Terrabyte hochsensibler Daten stolpert, und wie es gelingt, aus einer Datenwolke eine gesellschaftlich relevante Geschichte zu machen, und welche ethischen Fragen sich dabei auftun. Und wie arbeiten IT-Experten:innen und Journalist:innen zusammen? Wo liegen die Schwierigkeiten und wo das Potential?
Mit: Carl Fabian Lüpke (White-Hat-Hacker)
Moderation: Michael Scheurer (freischaffend)
Wir wissen wo dein Auto steht
Der Hack beim VW-Konzern wäre auch gelangweilten Teenagern gelungen. So beschreibt Hacker Flüpke (Chaos Computer Club Berlin), wie er und sein Team an die Bewegungsdaten von 800'000 Autos des VW-Konzerns gelangt sind.
In einer vielbeachteten Recherche für den Spiegel konnte Flüpke zusammen mit Co-Autor:innen damit Brisantes zeigen. So verrieten die Daten etwa, wer beim Bundesnachrichtendienst arbeitet, wer im Berliner Grossbordell Artemis ein- und ausgeht. Oder welche Personen zum Militärflugplatz der United States Air Force in Ramstein fahren. Sogar Bewegungen von Fahrzeugen in der Ukraine und Israel waren nachvollziehbar.
Wir diskutieren die Fragen, wo man im Internet über 9 Terrabyte hochsensibler Daten stolpert, und wie es gelingt, aus einer Datenwolke eine gesellschaftlich relevante Geschichte zu machen, und welche ethischen Fragen sich dabei auftun. Und wie arbeiten IT-Experten:innen und Journalist:innen zusammen? Wo liegen die Schwierigkeiten und wo das Potential?
Mit: Carl Fabian Lüpke (White-Hat-Hacker)
Moderation: Michael Scheurer (freischaffend)
Wir wissen wo dein Auto steht
Der Hack beim VW-Konzern wäre auch gelangweilten Teenagern gelungen. So beschreibt Hacker Flüpke (Chaos Computer Club Berlin), wie er und sein Team an die Bewegungsdaten von 800'000 Autos des VW-Konzerns gelangt sind.
In einer vielbeachteten Recherche für den Spiegel konnte Flüpke zusammen mit Co-Autor:innen damit Brisantes zeigen. So verrieten die Daten etwa, wer beim Bundesnachrichtendienst arbeitet, wer im Berliner Grossbordell Artemis ein- und ausgeht. Oder welche Personen zum Militärflugplatz der United States Air Force in Ramstein fahren. Sogar Bewegungen von Fahrzeugen in der Ukraine und Israel waren nachvollziehbar.
Wir diskutieren die Fragen, wo man im Internet über 9 Terrabyte hochsensibler Daten stolpert, und wie es gelingt, aus einer Datenwolke eine gesellschaftlich relevante Geschichte zu machen, und welche ethischen Fragen sich dabei auftun. Und wie arbeiten IT-Experten:innen und Journalist:innen zusammen? Wo liegen die Schwierigkeiten und wo das Potential?
Mit: Carl Fabian Lüpke (White-Hat-Hacker)
Moderation: Michael Scheurer (freischaffend)
Wir wissen wo dein Auto steht
Der Hack beim VW-Konzern wäre auch gelangweilten Teenagern gelungen. So beschreibt Hacker Flüpke (Chaos Computer Club Berlin), wie er und sein Team an die Bewegungsdaten von 800'000 Autos des VW-Konzerns gelangt sind.
In einer vielbeachteten Recherche für den Spiegel konnte Flüpke zusammen mit Co-Autor:innen damit Brisantes zeigen. So verrieten die Daten etwa, wer beim Bundesnachrichtendienst arbeitet, wer im Berliner Grossbordell Artemis ein- und ausgeht. Oder welche Personen zum Militärflugplatz der United States Air Force in Ramstein fahren. Sogar Bewegungen von Fahrzeugen in der Ukraine und Israel waren nachvollziehbar.
Wir diskutieren die Fragen, wo man im Internet über 9 Terrabyte hochsensibler Daten stolpert, und wie es gelingt, aus einer Datenwolke eine gesellschaftlich relevante Geschichte zu machen, und welche ethischen Fragen sich dabei auftun. Und wie arbeiten IT-Experten:innen und Journalist:innen zusammen? Wo liegen die Schwierigkeiten und wo das Potential?
Mit: Carl Fabian Lüpke (White-Hat-Hacker)
Moderation: Michael Scheurer (freischaffend)
Workshop: Vom Thema zur Geschichte
Wer schreibt, kennt das Gefühl: Manche Themen zerrieseln beim Pitchen wie Sand zwischen den Fingern. Klimaerwärmung, Bürokratie, Leistung im Sport. Solche Stoffe sind immer wieder auf der Agenda, aber schwer zu fassen.
Wann ist eine Reportage geeignet, komplexe Themen spannend zu vermitteln? Wo fangen wir an und wo lohnt es sich, hinzuschauen? Wo eher nicht – weil dort alle schon waren? Wie können wir trockene Statistiken mit Protagonist:innen zum Leben erwecken? Wie wird selbst aus einem Thema, das unspektakulär klingt, eine interessante, lebendige Geschichte?
In diesem Workshop sprechen die «Magazin»-Journalisten Christof Gertsch und Mikael Krogerus über ihre Tricks, erfolgreiche Handgriffe und Recherche-Erfahrungen. Grundlage sind zwei seiner Texte – einer über das Meer, der andere über einen Gletscher in der Antarktis. Anschliessend diskutieren wir im Plenum über Recherche-Ideen, die schon lange in unseren Köpfen herumschwirren. Für die aber bislang der konkrete Plan fehlt.
Der Workshop ist auf 20 Teilnehmer:innen beschränkt. Wenn du dabei sein willst, schicke bitte vier bis fünf Sätze zu einer noch unausgereiften Recherche-Idee an anmeldung@reporter-forum.ch. First come, first served.
Mit: Christof Gertsch (Das Magazin) und Mikael Krogerus
Moderation: Daniel Faulhaber (Beobachter)
Workshop: Vom Thema zur Geschichte
Wer schreibt, kennt das Gefühl: Manche Themen zerrieseln beim Pitchen wie Sand zwischen den Fingern. Klimaerwärmung, Bürokratie, Leistung im Sport. Solche Stoffe sind immer wieder auf der Agenda, aber schwer zu fassen.
Wann ist eine Reportage geeignet, komplexe Themen spannend zu vermitteln? Wo fangen wir an und wo lohnt es sich, hinzuschauen? Wo eher nicht – weil dort alle schon waren? Wie können wir trockene Statistiken mit Protagonist:innen zum Leben erwecken? Wie wird selbst aus einem Thema, das unspektakulär klingt, eine interessante, lebendige Geschichte?
In diesem Workshop sprechen die «Magazin»-Journalisten Christof Gertsch und Mikael Krogerus über ihre Tricks, erfolgreiche Handgriffe und Recherche-Erfahrungen. Grundlage sind zwei seiner Texte – einer über das Meer, der andere über einen Gletscher in der Antarktis. Anschliessend diskutieren wir im Plenum über Recherche-Ideen, die schon lange in unseren Köpfen herumschwirren. Für die aber bislang der konkrete Plan fehlt.
Der Workshop ist auf 20 Teilnehmer:innen beschränkt. Wenn du dabei sein willst, schicke bitte vier bis fünf Sätze zu einer noch unausgereiften Recherche-Idee an anmeldung@reporter-forum.ch. First come, first served.
Mit: Christof Gertsch (Das Magazin) und Mikael Krogerus
Moderation: Daniel Faulhaber (Beobachter)
Workshop: Vom Thema zur Geschichte
Wer schreibt, kennt das Gefühl: Manche Themen zerrieseln beim Pitchen wie Sand zwischen den Fingern. Klimaerwärmung, Bürokratie, Leistung im Sport. Solche Stoffe sind immer wieder auf der Agenda, aber schwer zu fassen.
Wann ist eine Reportage geeignet, komplexe Themen spannend zu vermitteln? Wo fangen wir an und wo lohnt es sich, hinzuschauen? Wo eher nicht – weil dort alle schon waren? Wie können wir trockene Statistiken mit Protagonist:innen zum Leben erwecken? Wie wird selbst aus einem Thema, das unspektakulär klingt, eine interessante, lebendige Geschichte?
In diesem Workshop sprechen die «Magazin»-Journalisten Christof Gertsch und Mikael Krogerus über ihre Tricks, erfolgreiche Handgriffe und Recherche-Erfahrungen. Grundlage sind zwei seiner Texte – einer über das Meer, der andere über einen Gletscher in der Antarktis. Anschliessend diskutieren wir im Plenum über Recherche-Ideen, die schon lange in unseren Köpfen herumschwirren. Für die aber bislang der konkrete Plan fehlt.
Der Workshop ist auf 20 Teilnehmer:innen beschränkt. Wenn du dabei sein willst, schicke bitte vier bis fünf Sätze zu einer noch unausgereiften Recherche-Idee an anmeldung@reporter-forum.ch. First come, first served.
Mit: Christof Gertsch (Das Magazin) und Mikael Krogerus
Moderation: Daniel Faulhaber (Beobachter)
Workshop: Vom Thema zur Geschichte
Wer schreibt, kennt das Gefühl: Manche Themen zerrieseln beim Pitchen wie Sand zwischen den Fingern. Klimaerwärmung, Bürokratie, Leistung im Sport. Solche Stoffe sind immer wieder auf der Agenda, aber schwer zu fassen.
Wann ist eine Reportage geeignet, komplexe Themen spannend zu vermitteln? Wo fangen wir an und wo lohnt es sich, hinzuschauen? Wo eher nicht – weil dort alle schon waren? Wie können wir trockene Statistiken mit Protagonist:innen zum Leben erwecken? Wie wird selbst aus einem Thema, das unspektakulär klingt, eine interessante, lebendige Geschichte?
In diesem Workshop sprechen die «Magazin»-Journalisten Christof Gertsch und Mikael Krogerus über ihre Tricks, erfolgreiche Handgriffe und Recherche-Erfahrungen. Grundlage sind zwei seiner Texte – einer über das Meer, der andere über einen Gletscher in der Antarktis. Anschliessend diskutieren wir im Plenum über Recherche-Ideen, die schon lange in unseren Köpfen herumschwirren. Für die aber bislang der konkrete Plan fehlt.
Der Workshop ist auf 20 Teilnehmer:innen beschränkt. Wenn du dabei sein willst, schicke bitte vier bis fünf Sätze zu einer noch unausgereiften Recherche-Idee an anmeldung@reporter-forum.ch. First come, first served.
Mit: Christof Gertsch (Das Magazin) und Mikael Krogerus
Moderation: Daniel Faulhaber (Beobachter)
Workshop: Vom Thema zur Geschichte
Wer schreibt, kennt das Gefühl: Manche Themen zerrieseln beim Pitchen wie Sand zwischen den Fingern. Klimaerwärmung, Bürokratie, Leistung im Sport. Solche Stoffe sind immer wieder auf der Agenda, aber schwer zu fassen.
Wann ist eine Reportage geeignet, komplexe Themen spannend zu vermitteln? Wo fangen wir an und wo lohnt es sich, hinzuschauen? Wo eher nicht – weil dort alle schon waren? Wie können wir trockene Statistiken mit Protagonist:innen zum Leben erwecken? Wie wird selbst aus einem Thema, das unspektakulär klingt, eine interessante, lebendige Geschichte?
In diesem Workshop sprechen die «Magazin»-Journalisten Christof Gertsch und Mikael Krogerus über ihre Tricks, erfolgreiche Handgriffe und Recherche-Erfahrungen. Grundlage sind zwei seiner Texte – einer über das Meer, der andere über einen Gletscher in der Antarktis. Anschliessend diskutieren wir im Plenum über Recherche-Ideen, die schon lange in unseren Köpfen herumschwirren. Für die aber bislang der konkrete Plan fehlt.
Der Workshop ist auf 20 Teilnehmer:innen beschränkt. Wenn du dabei sein willst, schicke bitte vier bis fünf Sätze zu einer noch unausgereiften Recherche-Idee an anmeldung@reporter-forum.ch. First come, first served.
Mit: Christof Gertsch (Das Magazin) und Mikael Krogerus
Moderation: Daniel Faulhaber (Beobachter)
«Kill List» – hinter der globalen Darknet-Recherche
Ein Team britischer Journalisten erhält eine unheimliche Liste: Mit Namen von Menschen, die jemand loswerden will – über eine Webseite, die im Darknet Auftragsmorde anbietet. Daraus entsteht mit «Kill List» (Wondery/Novel) ein aufsehenserregender Podcast, der Einblick gibt in menschliche Abgründe und in die Ohnmacht der Behörden. Eine weltweite Recherche mit Schweiz-Bezug: Audiojournalistin Franziska Engelhardt ging einer Todesdrohung im Kanton Zürich nach. Wie geht man an eine so ungeheuerliche Recherche heran? Wie schützt man sich als Journalistin? Und wie funktioniert die internationale Zusammenarbeit? Darüber sprechen wir in diesem Werkstattgespräch. Das Gespräch findet auf Englisch statt.
Mit: Franziska Engelhardt (freiberufliche Journalistin und Audioproduzentin), Caroline Thornham (Senior Producerin, Novel) und Tom Wright (Senior Producer, Novel)
Moderation: Mirja Gabathuler (Tamedia)
«Kill List» – hinter der globalen Darknet-Recherche
Ein Team britischer Journalisten erhält eine unheimliche Liste: Mit Namen von Menschen, die jemand loswerden will – über eine Webseite, die im Darknet Auftragsmorde anbietet. Daraus entsteht mit «Kill List» (Wondery/Novel) ein aufsehenserregender Podcast, der Einblick gibt in menschliche Abgründe und in die Ohnmacht der Behörden. Eine weltweite Recherche mit Schweiz-Bezug: Audiojournalistin Franziska Engelhardt ging einer Todesdrohung im Kanton Zürich nach. Wie geht man an eine so ungeheuerliche Recherche heran? Wie schützt man sich als Journalistin? Und wie funktioniert die internationale Zusammenarbeit? Darüber sprechen wir in diesem Werkstattgespräch. Das Gespräch findet auf Englisch statt.
Mit: Franziska Engelhardt (freiberufliche Journalistin und Audioproduzentin), Caroline Thornham (Senior Producerin, Novel) und Tom Wright (Senior Producer, Novel)
Moderation: Mirja Gabathuler (Tamedia)
«Kill List» – hinter der globalen Darknet-Recherche
Ein Team britischer Journalisten erhält eine unheimliche Liste: Mit Namen von Menschen, die jemand loswerden will – über eine Webseite, die im Darknet Auftragsmorde anbietet. Daraus entsteht mit «Kill List» (Wondery/Novel) ein aufsehenserregender Podcast, der Einblick gibt in menschliche Abgründe und in die Ohnmacht der Behörden. Eine weltweite Recherche mit Schweiz-Bezug: Audiojournalistin Franziska Engelhardt ging einer Todesdrohung im Kanton Zürich nach. Wie geht man an eine so ungeheuerliche Recherche heran? Wie schützt man sich als Journalistin? Und wie funktioniert die internationale Zusammenarbeit? Darüber sprechen wir in diesem Werkstattgespräch. Das Gespräch findet auf Englisch statt.
Mit: Franziska Engelhardt (freiberufliche Journalistin und Audioproduzentin), Caroline Thornham (Senior Producerin, Novel) und Tom Wright (Senior Producer, Novel)
Moderation: Mirja Gabathuler (Tamedia)
«Kill List» – hinter der globalen Darknet-Recherche
Ein Team britischer Journalisten erhält eine unheimliche Liste: Mit Namen von Menschen, die jemand loswerden will – über eine Webseite, die im Darknet Auftragsmorde anbietet. Daraus entsteht mit «Kill List» (Wondery/Novel) ein aufsehenserregender Podcast, der Einblick gibt in menschliche Abgründe und in die Ohnmacht der Behörden. Eine weltweite Recherche mit Schweiz-Bezug: Audiojournalistin Franziska Engelhardt ging einer Todesdrohung im Kanton Zürich nach. Wie geht man an eine so ungeheuerliche Recherche heran? Wie schützt man sich als Journalistin? Und wie funktioniert die internationale Zusammenarbeit? Darüber sprechen wir in diesem Werkstattgespräch. Das Gespräch findet auf Englisch statt.
Mit: Franziska Engelhardt (freiberufliche Journalistin und Audioproduzentin), Caroline Thornham (Senior Producerin, Novel) und Tom Wright (Senior Producer, Novel)
Moderation: Mirja Gabathuler (Tamedia)
«Kill List» – hinter der globalen Darknet-Recherche
Ein Team britischer Journalisten erhält eine unheimliche Liste: Mit Namen von Menschen, die jemand loswerden will – über eine Webseite, die im Darknet Auftragsmorde anbietet. Daraus entsteht mit «Kill List» (Wondery/Novel) ein aufsehenserregender Podcast, der Einblick gibt in menschliche Abgründe und in die Ohnmacht der Behörden. Eine weltweite Recherche mit Schweiz-Bezug: Audiojournalistin Franziska Engelhardt ging einer Todesdrohung im Kanton Zürich nach. Wie geht man an eine so ungeheuerliche Recherche heran? Wie schützt man sich als Journalistin? Und wie funktioniert die internationale Zusammenarbeit? Darüber sprechen wir in diesem Werkstattgespräch. Das Gespräch findet auf Englisch statt.
Mit: Franziska Engelhardt (freiberufliche Journalistin und Audioproduzentin), Caroline Thornham (Senior Producerin, Novel) und Tom Wright (Senior Producer, Novel)
Moderation: Mirja Gabathuler (Tamedia)
Die Vergessenen – Krisen unter dem Radar
Des einen Leid berührt und betrifft uns mehr als jenes anderer. Was kann der Auslandjournalismus gegen festgefahrene Perspektiven und Wahrnehmungsmuster tun? Mit Sarah Fluck und Wolfgang Bauer diskutieren wir über die Berichterstattung im Schatten der dominierenden Konflikte. Wir beleuchten dabei zwei verschiedene Formen der Auslandberichterstattung. Fluck als klassische Korrespondentin, die ihren Lebensmittelpunkt vor Ort hat. Bauer als Reporter, der die Krisengebiete explizit für seine Reportagen bereist und erkundet.
Mit: Sarah Fluck (SRF) und Wolfgang Bauer (ZEIT)
Moderation: Karin A. Wenger (Freie Journalistin)
Die Vergessenen – Krisen unter dem Radar
Des einen Leid berührt und betrifft uns mehr als jenes anderer. Was kann der Auslandjournalismus gegen festgefahrene Perspektiven und Wahrnehmungsmuster tun? Mit Sarah Fluck und Wolfgang Bauer diskutieren wir über die Berichterstattung im Schatten der dominierenden Konflikte. Wir beleuchten dabei zwei verschiedene Formen der Auslandberichterstattung. Fluck als klassische Korrespondentin, die ihren Lebensmittelpunkt vor Ort hat. Bauer als Reporter, der die Krisengebiete explizit für seine Reportagen bereist und erkundet.
Mit: Sarah Fluck (SRF) und Wolfgang Bauer (ZEIT)
Moderation: Karin A. Wenger (Freie Journalistin)
Die Vergessenen – Krisen unter dem Radar
Des einen Leid berührt und betrifft uns mehr als jenes anderer. Was kann der Auslandjournalismus gegen festgefahrene Perspektiven und Wahrnehmungsmuster tun? Mit Sarah Fluck und Wolfgang Bauer diskutieren wir über die Berichterstattung im Schatten der dominierenden Konflikte. Wir beleuchten dabei zwei verschiedene Formen der Auslandberichterstattung. Fluck als klassische Korrespondentin, die ihren Lebensmittelpunkt vor Ort hat. Bauer als Reporter, der die Krisengebiete explizit für seine Reportagen bereist und erkundet.
Mit: Sarah Fluck (SRF) und Wolfgang Bauer (ZEIT)
Moderation: Karin A. Wenger (Freie Journalistin)
Die Vergessenen – Krisen unter dem Radar
Des einen Leid berührt und betrifft uns mehr als jenes anderer. Was kann der Auslandjournalismus gegen festgefahrene Perspektiven und Wahrnehmungsmuster tun? Mit Sarah Fluck und Wolfgang Bauer diskutieren wir über die Berichterstattung im Schatten der dominierenden Konflikte. Wir beleuchten dabei zwei verschiedene Formen der Auslandberichterstattung. Fluck als klassische Korrespondentin, die ihren Lebensmittelpunkt vor Ort hat. Bauer als Reporter, der die Krisengebiete explizit für seine Reportagen bereist und erkundet.
Mit: Sarah Fluck (SRF) und Wolfgang Bauer (ZEIT)
Moderation: Karin A. Wenger (Freie Journalistin)
Die Vergessenen – Krisen unter dem Radar
Des einen Leid berührt und betrifft uns mehr als jenes anderer. Was kann der Auslandjournalismus gegen festgefahrene Perspektiven und Wahrnehmungsmuster tun? Mit Sarah Fluck und Wolfgang Bauer diskutieren wir über die Berichterstattung im Schatten der dominierenden Konflikte. Wir beleuchten dabei zwei verschiedene Formen der Auslandberichterstattung. Fluck als klassische Korrespondentin, die ihren Lebensmittelpunkt vor Ort hat. Bauer als Reporter, der die Krisengebiete explizit für seine Reportagen bereist und erkundet.
Mit: Sarah Fluck (SRF) und Wolfgang Bauer (ZEIT)
Moderation: Karin A. Wenger (Freie Journalistin)
Lokal, unabhängig, innovativ
Im Lokaljournalismus ist die Medienfinanzierungskrise am stärksten spürbar. Es wird abgebaut und zusammengelegt. Es nervt. Aber längstens nicht alle Entwicklungen im Lokaljournalismus geben Anlass zum Ärgern! Überall in der Schweiz gibt es innovative Projekte. Sie sind brandneu und haben viel vor – oder haben sich etwa vor Jahren von Tamedia losgelöst und etabliert. Manche sind online, andere kommen als Anschlagbrett daher. Oder sie verkaufen ihre Abos auf dem Jahrmarkt.
Von solchen Ideen wollen wir uns inspirieren lassen und sechs spannende Lokaljournalismus-Projekte (besser) kennenlernen. Und wer weiss, vielleicht lässt sich ja der eine oder die andere im Publikum davon inspirieren und gründet selbst ein Lokalblatt?
Wir stellen vor:
«Anschlag 56» (Basel BS)
«Journal de Morges» (Morges VD)
«Kolumna» (Lindau am Bodensee D)
«Spatz» (Alttoggenburg SG, Unterrheintal SG, Versoix GE)
«Wnti» (Winterthur ZH)
Mit: Hans-Jörg Walter (Anschlag 56), Tizian Schöni (Wnti), Hannes Grassegger (Spatz), Julia Baumann (Kolumna) und Felix Mann (Journal de Morges)
Moderation: Jana Schmid (Hauptstadt)
Lokal, unabhängig, innovativ
Im Lokaljournalismus ist die Medienfinanzierungskrise am stärksten spürbar. Es wird abgebaut und zusammengelegt. Es nervt. Aber längstens nicht alle Entwicklungen im Lokaljournalismus geben Anlass zum Ärgern! Überall in der Schweiz gibt es innovative Projekte. Sie sind brandneu und haben viel vor – oder haben sich etwa vor Jahren von Tamedia losgelöst und etabliert. Manche sind online, andere kommen als Anschlagbrett daher. Oder sie verkaufen ihre Abos auf dem Jahrmarkt.
Von solchen Ideen wollen wir uns inspirieren lassen und sechs spannende Lokaljournalismus-Projekte (besser) kennenlernen. Und wer weiss, vielleicht lässt sich ja der eine oder die andere im Publikum davon inspirieren und gründet selbst ein Lokalblatt?
Wir stellen vor:
«Anschlag 56» (Basel BS)
«Journal de Morges» (Morges VD)
«Kolumna» (Lindau am Bodensee D)
«Spatz» (Alttoggenburg SG, Unterrheintal SG, Versoix GE)
«Wnti» (Winterthur ZH)
Mit: Hans-Jörg Walter (Anschlag 56), Tizian Schöni (Wnti), Hannes Grassegger (Spatz), Julia Baumann (Kolumna) und Felix Mann (Journal de Morges)
Moderation: Jana Schmid (Hauptstadt)
Lokal, unabhängig, innovativ
Im Lokaljournalismus ist die Medienfinanzierungskrise am stärksten spürbar. Es wird abgebaut und zusammengelegt. Es nervt. Aber längstens nicht alle Entwicklungen im Lokaljournalismus geben Anlass zum Ärgern! Überall in der Schweiz gibt es innovative Projekte. Sie sind brandneu und haben viel vor – oder haben sich etwa vor Jahren von Tamedia losgelöst und etabliert. Manche sind online, andere kommen als Anschlagbrett daher. Oder sie verkaufen ihre Abos auf dem Jahrmarkt.
Von solchen Ideen wollen wir uns inspirieren lassen und sechs spannende Lokaljournalismus-Projekte (besser) kennenlernen. Und wer weiss, vielleicht lässt sich ja der eine oder die andere im Publikum davon inspirieren und gründet selbst ein Lokalblatt?
Wir stellen vor:
«Anschlag 56» (Basel BS)
«Journal de Morges» (Morges VD)
«Kolumna» (Lindau am Bodensee D)
«Spatz» (Alttoggenburg SG, Unterrheintal SG, Versoix GE)
«Wnti» (Winterthur ZH)
Mit: Hans-Jörg Walter (Anschlag 56), Tizian Schöni (Wnti), Hannes Grassegger (Spatz), Julia Baumann (Kolumna) und Felix Mann (Journal de Morges)
Moderation: Jana Schmid (Hauptstadt)
Lokal, unabhängig, innovativ
Im Lokaljournalismus ist die Medienfinanzierungskrise am stärksten spürbar. Es wird abgebaut und zusammengelegt. Es nervt. Aber längstens nicht alle Entwicklungen im Lokaljournalismus geben Anlass zum Ärgern! Überall in der Schweiz gibt es innovative Projekte. Sie sind brandneu und haben viel vor – oder haben sich etwa vor Jahren von Tamedia losgelöst und etabliert. Manche sind online, andere kommen als Anschlagbrett daher. Oder sie verkaufen ihre Abos auf dem Jahrmarkt.
Von solchen Ideen wollen wir uns inspirieren lassen und sechs spannende Lokaljournalismus-Projekte (besser) kennenlernen. Und wer weiss, vielleicht lässt sich ja der eine oder die andere im Publikum davon inspirieren und gründet selbst ein Lokalblatt?
Wir stellen vor:
«Anschlag 56» (Basel BS)
«Journal de Morges» (Morges VD)
«Kolumna» (Lindau am Bodensee D)
«Spatz» (Alttoggenburg SG, Unterrheintal SG, Versoix GE)
«Wnti» (Winterthur ZH)
Mit: Hans-Jörg Walter (Anschlag 56), Tizian Schöni (Wnti), Hannes Grassegger (Spatz), Julia Baumann (Kolumna) und Felix Mann (Journal de Morges)
Moderation: Jana Schmid (Hauptstadt)
Lokal, unabhängig, innovativ
Im Lokaljournalismus ist die Medienfinanzierungskrise am stärksten spürbar. Es wird abgebaut und zusammengelegt. Es nervt. Aber längstens nicht alle Entwicklungen im Lokaljournalismus geben Anlass zum Ärgern! Überall in der Schweiz gibt es innovative Projekte. Sie sind brandneu und haben viel vor – oder haben sich etwa vor Jahren von Tamedia losgelöst und etabliert. Manche sind online, andere kommen als Anschlagbrett daher. Oder sie verkaufen ihre Abos auf dem Jahrmarkt.
Von solchen Ideen wollen wir uns inspirieren lassen und sechs spannende Lokaljournalismus-Projekte (besser) kennenlernen. Und wer weiss, vielleicht lässt sich ja der eine oder die andere im Publikum davon inspirieren und gründet selbst ein Lokalblatt?
Wir stellen vor:
«Anschlag 56» (Basel BS)
«Journal de Morges» (Morges VD)
«Kolumna» (Lindau am Bodensee D)
«Spatz» (Alttoggenburg SG, Unterrheintal SG, Versoix GE)
«Wnti» (Winterthur ZH)
Mit: Hans-Jörg Walter (Anschlag 56), Tizian Schöni (Wnti), Hannes Grassegger (Spatz), Julia Baumann (Kolumna) und Felix Mann (Journal de Morges)
Moderation: Jana Schmid (Hauptstadt)
Workshop: Witzig schreiben
Gerade wenn die Nachrichtenlage düster ist, freuen sich Redaktionen über lustige Abwechslung. Aber wie schreibt man witzig, ohne dass es verkrampft wirkt - und ohne gemein zu sein? Julia Kopatzki gelingt das immer wieder: In Texten über Spargelköniginnen, eine 9-Monatige Kreuzfahrt oder Coaching-Gurus.
In diesem Workshop teilt sie mit uns die Tricks und Einsichten, die sie in Jahren des lustigen Schreibens gewonnen hat.
Mit: Julia Kopatzki (Reporter-Ressort SPIEGEL)
Workshop: Witzig schreiben
Gerade wenn die Nachrichtenlage düster ist, freuen sich Redaktionen über lustige Abwechslung. Aber wie schreibt man witzig, ohne dass es verkrampft wirkt - und ohne gemein zu sein? Julia Kopatzki gelingt das immer wieder: In Texten über Spargelköniginnen, eine 9-Monatige Kreuzfahrt oder Coaching-Gurus.
In diesem Workshop teilt sie mit uns die Tricks und Einsichten, die sie in Jahren des lustigen Schreibens gewonnen hat.
Mit: Julia Kopatzki (Reporter-Ressort SPIEGEL)
Workshop: Witzig schreiben
Gerade wenn die Nachrichtenlage düster ist, freuen sich Redaktionen über lustige Abwechslung. Aber wie schreibt man witzig, ohne dass es verkrampft wirkt - und ohne gemein zu sein? Julia Kopatzki gelingt das immer wieder: In Texten über Spargelköniginnen, eine 9-Monatige Kreuzfahrt oder Coaching-Gurus.
In diesem Workshop teilt sie mit uns die Tricks und Einsichten, die sie in Jahren des lustigen Schreibens gewonnen hat.
Mit: Julia Kopatzki (Reporter-Ressort SPIEGEL)
Workshop: Witzig schreiben
Gerade wenn die Nachrichtenlage düster ist, freuen sich Redaktionen über lustige Abwechslung. Aber wie schreibt man witzig, ohne dass es verkrampft wirkt - und ohne gemein zu sein? Julia Kopatzki gelingt das immer wieder: In Texten über Spargelköniginnen, eine 9-Monatige Kreuzfahrt oder Coaching-Gurus.
In diesem Workshop teilt sie mit uns die Tricks und Einsichten, die sie in Jahren des lustigen Schreibens gewonnen hat.
Mit: Julia Kopatzki (Reporter-Ressort SPIEGEL)
Workshop: Witzig schreiben
Gerade wenn die Nachrichtenlage düster ist, freuen sich Redaktionen über lustige Abwechslung. Aber wie schreibt man witzig, ohne dass es verkrampft wirkt - und ohne gemein zu sein? Julia Kopatzki gelingt das immer wieder: In Texten über Spargelköniginnen, eine 9-Monatige Kreuzfahrt oder Coaching-Gurus.
In diesem Workshop teilt sie mit uns die Tricks und Einsichten, die sie in Jahren des lustigen Schreibens gewonnen hat.
Mit: Julia Kopatzki (Reporter-Ressort SPIEGEL)
SRF nüm bi de Lüt?!
Übernahmen, Mittelkürzungen, Schliessungen: Öffentlich-rechtliche Medien stehen zunehmend unter Druck. Betroffen ist nicht nur die SRG mit Radio und Fernsehen SRF – auch in Österreich, Deutschland und vielen weiteren Ländern häufen sich politisch motivierte Versuche, die Pressefreiheit einzuschränken. Was bedeutet diese Entwicklung für unseren Berufsstand? Wie können wir Journalist:innen damit umgehen und welche Folgen hätte die Halbierungs-Initiative für die Medienbranche in der Schweiz?
Mit: Sissi Pitzer (deutsche Medienjournalistin und Moderatorin), Salvador Atasoy (Präsident Schweizer Mediengewerkschaft SSM) und Dennis Bühler (Republik)
Moderation: Sophie Reinhardt (Blick)
Mittagspause
Das Mittagessen (Menüsalat, Hauptgang, Tafelwasser, Tee und 1 Kaffee/Espresso) ist für Teilnehmende im Preis inklusive.

Journalismus am Limit: Strategien, um im Medienalltag zu bestehen
Kündigungswellen, prekäre Arbeitsverhältnisse, Krieg und Krisen: Der Alltag als Journalist:in wird schwieriger. Junge Talente kämpfen um Gehör, während Routinierte sich mit Erschöpfung und Perspektivenlosigkeit herumschlagen.
Wie bewältigt man Angst und Stress im Job? Wie geht man mit destruktiven Nachrichtenfluten um? Wie verschafft man sich als junge:r Journalist:in Gehör? Und wie plant man eine Zukunft in einer Branche im Umbruch?
Unsere fünf Expert:innen kennen die Herausforderungen im Journalismus und bieten dir einen niederschwelligen Austausch, Unterstützung und neue Strategien: Komm in die Runde, sitze zur Expert:in deiner Wahl an den Tisch, lass dich von einem Input inspirieren und stelle im Anschluss deine Fragen in einer kleinen und intimen Runde.
Folgende Gäst:innen haben Inputs zu folgenden Themen und ein offenes Ohr für dich:
Resilienz oder die Kraft, schwierige Situationen zu meistern: Thomas Mathys (Sprech- und Auftrittscoach SRF)
Doomsday im Newsroom: Wie umgehen mit belastenden Nachrichten? Marisa Eggli (Nachrichtenredaktorin SRF)
Wie schaffen Junge den Einstieg in den Journalismus? Juan Riande (Junge Journalistinnen und Journalisten Schweiz) und Olivia Ruffiner (Podcast Durchblick)
Wie komme ich an Geld für eine journalistische Recherche? Stefanie Müller-Frank (freie Reporterin) und Jennifer Steiner (WAV Recherchekollektiv)
Journalismus am Limit: Strategien, um im Medienalltag zu bestehen
Kündigungswellen, prekäre Arbeitsverhältnisse, Krieg und Krisen: Der Alltag als Journalist:in wird schwieriger. Junge Talente kämpfen um Gehör, während Routinierte sich mit Erschöpfung und Perspektivenlosigkeit herumschlagen.
Wie bewältigt man Angst und Stress im Job? Wie geht man mit destruktiven Nachrichtenfluten um? Wie verschafft man sich als junge:r Journalist:in Gehör? Und wie plant man eine Zukunft in einer Branche im Umbruch?
Unsere fünf Expert:innen kennen die Herausforderungen im Journalismus und bieten dir einen niederschwelligen Austausch, Unterstützung und neue Strategien: Komm in die Runde, sitze zur Expert:in deiner Wahl an den Tisch, lass dich von einem Input inspirieren und stelle im Anschluss deine Fragen in einer kleinen und intimen Runde.
Folgende Gäst:innen haben Inputs zu folgenden Themen und ein offenes Ohr für dich:
Resilienz oder die Kraft, schwierige Situationen zu meistern: Thomas Mathys (Sprech- und Auftrittscoach SRF)
Doomsday im Newsroom: Wie umgehen mit belastenden Nachrichten? Marisa Eggli (Nachrichtenredaktorin SRF)
Wie schaffen Junge den Einstieg in den Journalismus? Juan Riande (Junge Journalistinnen und Journalisten Schweiz) und Olivia Ruffiner (Podcast Durchblick)
Wie komme ich an Geld für eine journalistische Recherche? Stefanie Müller-Frank (freie Reporterin) und Jennifer Steiner (WAV Recherchekollektiv)
Journalismus am Limit: Strategien, um im Medienalltag zu bestehen
Kündigungswellen, prekäre Arbeitsverhältnisse, Krieg und Krisen: Der Alltag als Journalist:in wird schwieriger. Junge Talente kämpfen um Gehör, während Routinierte sich mit Erschöpfung und Perspektivenlosigkeit herumschlagen.
Wie bewältigt man Angst und Stress im Job? Wie geht man mit destruktiven Nachrichtenfluten um? Wie verschafft man sich als junge:r Journalist:in Gehör? Und wie plant man eine Zukunft in einer Branche im Umbruch?
Unsere fünf Expert:innen kennen die Herausforderungen im Journalismus und bieten dir einen niederschwelligen Austausch, Unterstützung und neue Strategien: Komm in die Runde, sitze zur Expert:in deiner Wahl an den Tisch, lass dich von einem Input inspirieren und stelle im Anschluss deine Fragen in einer kleinen und intimen Runde.
Folgende Gäst:innen haben Inputs zu folgenden Themen und ein offenes Ohr für dich:
Resilienz oder die Kraft, schwierige Situationen zu meistern: Thomas Mathys (Sprech- und Auftrittscoach SRF)
Doomsday im Newsroom: Wie umgehen mit belastenden Nachrichten? Marisa Eggli (Nachrichtenredaktorin SRF)
Wie schaffen Junge den Einstieg in den Journalismus? Juan Riande (Junge Journalistinnen und Journalisten Schweiz) und Olivia Ruffiner (Podcast Durchblick)
Wie komme ich an Geld für eine journalistische Recherche? Stefanie Müller-Frank (freie Reporterin) und Jennifer Steiner (WAV Recherchekollektiv)
Journalismus am Limit: Strategien, um im Medienalltag zu bestehen
Kündigungswellen, prekäre Arbeitsverhältnisse, Krieg und Krisen: Der Alltag als Journalist:in wird schwieriger. Junge Talente kämpfen um Gehör, während Routinierte sich mit Erschöpfung und Perspektivenlosigkeit herumschlagen.
Wie bewältigt man Angst und Stress im Job? Wie geht man mit destruktiven Nachrichtenfluten um? Wie verschafft man sich als junge:r Journalist:in Gehör? Und wie plant man eine Zukunft in einer Branche im Umbruch?
Unsere fünf Expert:innen kennen die Herausforderungen im Journalismus und bieten dir einen niederschwelligen Austausch, Unterstützung und neue Strategien: Komm in die Runde, sitze zur Expert:in deiner Wahl an den Tisch, lass dich von einem Input inspirieren und stelle im Anschluss deine Fragen in einer kleinen und intimen Runde.
Folgende Gäst:innen haben Inputs zu folgenden Themen und ein offenes Ohr für dich:
Resilienz oder die Kraft, schwierige Situationen zu meistern: Thomas Mathys (Sprech- und Auftrittscoach SRF)
Doomsday im Newsroom: Wie umgehen mit belastenden Nachrichten? Marisa Eggli (Nachrichtenredaktorin SRF)
Wie schaffen Junge den Einstieg in den Journalismus? Juan Riande (Junge Journalistinnen und Journalisten Schweiz) und Olivia Ruffiner (Podcast Durchblick)
Wie komme ich an Geld für eine journalistische Recherche? Stefanie Müller-Frank (freie Reporterin) und Jennifer Steiner (WAV Recherchekollektiv)
Zwischen Watchdog und Publikumsmagnet: Was können Gerichtsberichterstattung und True Crime voneinander lernen?
Journalistische Berichterstattung über Kriminalfälle und Gerichtsprozesse erreicht über Podcasts und Reportagen ein breites Publikum. Wenn klassische Justizrecherche auf Storytelling-Logiken trifft, ist der Spagat nicht immer einfach: Wie können komplexe Vorgänge vor Gericht der Öffentlichkeit verständlich vermittelt werden? Wie kann man Spannung und persönliche Nähe erzeugen, ohne bei Distanzlosigkeit oder Voyeurismus zu landen? Und kann Gerichtsberichterstattung vom Interesse für das Genre «True Crime» profitieren – oder ist sie dadurch in Gefahr? Diese Spannungsfelder diskutieren wir mit Anne Kunze, Kriminalreportertin der Zeit und Co-Host von «Zeit Verbrechen» und Brigitte Hürlimann, Gerichtsreporterin bei der «Republik» und Host von «Dritte Gewalt».
Mit: Brigitte Hürlimann (Republik) und Anne Kunze (Chefin des Podcasts ZEIT Verbrechen) (nimmt virtuell teil)
Moderation: Anina Ritscher (freischaffend)
Zwischen Watchdog und Publikumsmagnet: Was können Gerichtsberichterstattung und True Crime voneinander lernen?
Journalistische Berichterstattung über Kriminalfälle und Gerichtsprozesse erreicht über Podcasts und Reportagen ein breites Publikum. Wenn klassische Justizrecherche auf Storytelling-Logiken trifft, ist der Spagat nicht immer einfach: Wie können komplexe Vorgänge vor Gericht der Öffentlichkeit verständlich vermittelt werden? Wie kann man Spannung und persönliche Nähe erzeugen, ohne bei Distanzlosigkeit oder Voyeurismus zu landen? Und kann Gerichtsberichterstattung vom Interesse für das Genre «True Crime» profitieren – oder ist sie dadurch in Gefahr? Diese Spannungsfelder diskutieren wir mit Anne Kunze, Kriminalreportertin der Zeit und Co-Host von «Zeit Verbrechen» und Brigitte Hürlimann, Gerichtsreporterin bei der «Republik» und Host von «Dritte Gewalt».
Mit: Brigitte Hürlimann (Republik) und Anne Kunze (Chefin des Podcasts ZEIT Verbrechen) (nimmt virtuell teil)
Moderation: Anina Ritscher (freischaffend)
Zwischen Watchdog und Publikumsmagnet: Was können Gerichtsberichterstattung und True Crime voneinander lernen?
Journalistische Berichterstattung über Kriminalfälle und Gerichtsprozesse erreicht über Podcasts und Reportagen ein breites Publikum. Wenn klassische Justizrecherche auf Storytelling-Logiken trifft, ist der Spagat nicht immer einfach: Wie können komplexe Vorgänge vor Gericht der Öffentlichkeit verständlich vermittelt werden? Wie kann man Spannung und persönliche Nähe erzeugen, ohne bei Distanzlosigkeit oder Voyeurismus zu landen? Und kann Gerichtsberichterstattung vom Interesse für das Genre «True Crime» profitieren – oder ist sie dadurch in Gefahr? Diese Spannungsfelder diskutieren wir mit Anne Kunze, Kriminalreportertin der Zeit und Co-Host von «Zeit Verbrechen» und Brigitte Hürlimann, Gerichtsreporterin bei der «Republik» und Host von «Dritte Gewalt».
Mit: Brigitte Hürlimann (Republik) und Anne Kunze (Chefin des Podcasts ZEIT Verbrechen) (nimmt virtuell teil)
Moderation: Anina Ritscher (freischaffend)
Zwischen Watchdog und Publikumsmagnet: Was können Gerichtsberichterstattung und True Crime voneinander lernen?
Journalistische Berichterstattung über Kriminalfälle und Gerichtsprozesse erreicht über Podcasts und Reportagen ein breites Publikum. Wenn klassische Justizrecherche auf Storytelling-Logiken trifft, ist der Spagat nicht immer einfach: Wie können komplexe Vorgänge vor Gericht der Öffentlichkeit verständlich vermittelt werden? Wie kann man Spannung und persönliche Nähe erzeugen, ohne bei Distanzlosigkeit oder Voyeurismus zu landen? Und kann Gerichtsberichterstattung vom Interesse für das Genre «True Crime» profitieren – oder ist sie dadurch in Gefahr? Diese Spannungsfelder diskutieren wir mit Anne Kunze, Kriminalreportertin der Zeit und Co-Host von «Zeit Verbrechen» und Brigitte Hürlimann, Gerichtsreporterin bei der «Republik» und Host von «Dritte Gewalt».
Mit: Brigitte Hürlimann (Republik) und Anne Kunze (Chefin des Podcasts ZEIT Verbrechen) (nimmt virtuell teil)
Moderation: Anina Ritscher (freischaffend)
Zwischen Watchdog und Publikumsmagnet: Was können Gerichtsberichterstattung und True Crime voneinander lernen?
Journalistische Berichterstattung über Kriminalfälle und Gerichtsprozesse erreicht über Podcasts und Reportagen ein breites Publikum. Wenn klassische Justizrecherche auf Storytelling-Logiken trifft, ist der Spagat nicht immer einfach: Wie können komplexe Vorgänge vor Gericht der Öffentlichkeit verständlich vermittelt werden? Wie kann man Spannung und persönliche Nähe erzeugen, ohne bei Distanzlosigkeit oder Voyeurismus zu landen? Und kann Gerichtsberichterstattung vom Interesse für das Genre «True Crime» profitieren – oder ist sie dadurch in Gefahr? Diese Spannungsfelder diskutieren wir mit Anne Kunze, Kriminalreportertin der Zeit und Co-Host von «Zeit Verbrechen» und Brigitte Hürlimann, Gerichtsreporterin bei der «Republik» und Host von «Dritte Gewalt».
Mit: Brigitte Hürlimann (Republik) und Anne Kunze (Chefin des Podcasts ZEIT Verbrechen) (nimmt virtuell teil)
Moderation: Anina Ritscher (freischaffend)
Wenn Freiheit und Demokratie verstummen – Wie geht es weiter mit Radio Free Europe/Radio Liberty?
Die Nachricht war ein Schock: Kurze Zeit nach seinem zweiten Amtsantritt verkündete Donald Trump, die US-Gelder – rund 77 Millionen Dollar – die seit dem zweiten Weltkrieg jährlich die Finanzierung von Radio Free Europe/Radio Liberty garantierten, einzustellen. Als «Links-Propaganda» und «unnötigen Teil der Bundesbürokratie» bezeichnete Trump die beiden Sender. Vor rund 80 Jahren klang es noch ganz anders aus dem Oval Office. Damals riefen die USA Radio Free Europe/Radio Liberty ins Leben, um Werte wie Freiheit und Demokratie in die Länder hinter dem Eisernen Vorhang zu tragen. Auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war RFE/RL eine wichtige westliche Informationsquelle in den ehemaligen Sowjetstaaten, in China oder auch im Iran. Und wie sieht es heute aus? In Zeiten von Autokratisierung und wiedererstarktem Rechtspopulismus? Das Verbreiten von demokratisch freiheitlichen Werten scheint heute wichtiger denn je. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt: So hat die EU dem Sender 5,5 Millionen Euro zugesichert, eine «Notfinanzierung, um unabhängigen Journalismus sicherzustellen». Doch reicht das? Wir sprechen mit Charles Recknagel, Standarts Editor bei RFE/RL. Das Gespräch findet auf Englisch statt.
Mit: Charles Recknagel (Standards Editor bei Radio Free Europe/Radio Liberty)
Moderation: Igor Basic (SRF)
Wenn Freiheit und Demokratie verstummen – Wie geht es weiter mit Radio Free Europe/Radio Liberty?
Die Nachricht war ein Schock: Kurze Zeit nach seinem zweiten Amtsantritt verkündete Donald Trump, die US-Gelder – rund 77 Millionen Dollar – die seit dem zweiten Weltkrieg jährlich die Finanzierung von Radio Free Europe/Radio Liberty garantierten, einzustellen. Als «Links-Propaganda» und «unnötigen Teil der Bundesbürokratie» bezeichnete Trump die beiden Sender. Vor rund 80 Jahren klang es noch ganz anders aus dem Oval Office. Damals riefen die USA Radio Free Europe/Radio Liberty ins Leben, um Werte wie Freiheit und Demokratie in die Länder hinter dem Eisernen Vorhang zu tragen. Auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war RFE/RL eine wichtige westliche Informationsquelle in den ehemaligen Sowjetstaaten, in China oder auch im Iran. Und wie sieht es heute aus? In Zeiten von Autokratisierung und wiedererstarktem Rechtspopulismus? Das Verbreiten von demokratisch freiheitlichen Werten scheint heute wichtiger denn je. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt: So hat die EU dem Sender 5,5 Millionen Euro zugesichert, eine «Notfinanzierung, um unabhängigen Journalismus sicherzustellen». Doch reicht das? Wir sprechen mit Charles Recknagel, Standarts Editor bei RFE/RL. Das Gespräch findet auf Englisch statt.
Mit: Charles Recknagel (Standards Editor bei Radio Free Europe/Radio Liberty)
Moderation: Igor Basic (SRF)
Wenn Freiheit und Demokratie verstummen – Wie geht es weiter mit Radio Free Europe/Radio Liberty?
Die Nachricht war ein Schock: Kurze Zeit nach seinem zweiten Amtsantritt verkündete Donald Trump, die US-Gelder – rund 77 Millionen Dollar – die seit dem zweiten Weltkrieg jährlich die Finanzierung von Radio Free Europe/Radio Liberty garantierten, einzustellen. Als «Links-Propaganda» und «unnötigen Teil der Bundesbürokratie» bezeichnete Trump die beiden Sender. Vor rund 80 Jahren klang es noch ganz anders aus dem Oval Office. Damals riefen die USA Radio Free Europe/Radio Liberty ins Leben, um Werte wie Freiheit und Demokratie in die Länder hinter dem Eisernen Vorhang zu tragen. Auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war RFE/RL eine wichtige westliche Informationsquelle in den ehemaligen Sowjetstaaten, in China oder auch im Iran. Und wie sieht es heute aus? In Zeiten von Autokratisierung und wiedererstarktem Rechtspopulismus? Das Verbreiten von demokratisch freiheitlichen Werten scheint heute wichtiger denn je. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt: So hat die EU dem Sender 5,5 Millionen Euro zugesichert, eine «Notfinanzierung, um unabhängigen Journalismus sicherzustellen». Doch reicht das? Wir sprechen mit Charles Recknagel, Standarts Editor bei RFE/RL. Das Gespräch findet auf Englisch statt.
Mit: Charles Recknagel (Standards Editor bei Radio Free Europe/Radio Liberty)
Moderation: Igor Basic (SRF)
Wenn Freiheit und Demokratie verstummen – Wie geht es weiter mit Radio Free Europe/Radio Liberty?
Die Nachricht war ein Schock: Kurze Zeit nach seinem zweiten Amtsantritt verkündete Donald Trump, die US-Gelder – rund 77 Millionen Dollar – die seit dem zweiten Weltkrieg jährlich die Finanzierung von Radio Free Europe/Radio Liberty garantierten, einzustellen. Als «Links-Propaganda» und «unnötigen Teil der Bundesbürokratie» bezeichnete Trump die beiden Sender. Vor rund 80 Jahren klang es noch ganz anders aus dem Oval Office. Damals riefen die USA Radio Free Europe/Radio Liberty ins Leben, um Werte wie Freiheit und Demokratie in die Länder hinter dem Eisernen Vorhang zu tragen. Auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war RFE/RL eine wichtige westliche Informationsquelle in den ehemaligen Sowjetstaaten, in China oder auch im Iran. Und wie sieht es heute aus? In Zeiten von Autokratisierung und wiedererstarktem Rechtspopulismus? Das Verbreiten von demokratisch freiheitlichen Werten scheint heute wichtiger denn je. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt: So hat die EU dem Sender 5,5 Millionen Euro zugesichert, eine «Notfinanzierung, um unabhängigen Journalismus sicherzustellen». Doch reicht das? Wir sprechen mit Charles Recknagel, Standarts Editor bei RFE/RL. Das Gespräch findet auf Englisch statt.
Mit: Charles Recknagel (Standards Editor bei Radio Free Europe/Radio Liberty)
Moderation: Igor Basic (SRF)
Wenn Freiheit und Demokratie verstummen – Wie geht es weiter mit Radio Free Europe/Radio Liberty?
Die Nachricht war ein Schock: Kurze Zeit nach seinem zweiten Amtsantritt verkündete Donald Trump, die US-Gelder – rund 77 Millionen Dollar – die seit dem zweiten Weltkrieg jährlich die Finanzierung von Radio Free Europe/Radio Liberty garantierten, einzustellen. Als «Links-Propaganda» und «unnötigen Teil der Bundesbürokratie» bezeichnete Trump die beiden Sender. Vor rund 80 Jahren klang es noch ganz anders aus dem Oval Office. Damals riefen die USA Radio Free Europe/Radio Liberty ins Leben, um Werte wie Freiheit und Demokratie in die Länder hinter dem Eisernen Vorhang zu tragen. Auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war RFE/RL eine wichtige westliche Informationsquelle in den ehemaligen Sowjetstaaten, in China oder auch im Iran. Und wie sieht es heute aus? In Zeiten von Autokratisierung und wiedererstarktem Rechtspopulismus? Das Verbreiten von demokratisch freiheitlichen Werten scheint heute wichtiger denn je. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt: So hat die EU dem Sender 5,5 Millionen Euro zugesichert, eine «Notfinanzierung, um unabhängigen Journalismus sicherzustellen». Doch reicht das? Wir sprechen mit Charles Recknagel, Standarts Editor bei RFE/RL. Das Gespräch findet auf Englisch statt.
Mit: Charles Recknagel (Standards Editor bei Radio Free Europe/Radio Liberty)
Moderation: Igor Basic (SRF)
Der lange Schatten des Falles Pélicot - Recherche zu “chemischer Unterwerfung” auf Telegram
Im Herbst 2024 startete der Strafprozess gegen den Ex-Ehemann und Vergewaltiger von Gisèle Pélicot in Avignon. Und plötzlich redete die ganze Welt über sexualisierte Gewalt und chemische Unterwerfung. Isabelle Beer und Isabel Ströh beobachteten zu diesem Zeitpunkt schon seit Monaten Vergewaltiger-Netzwerken auf Telegram. Sie stiessen dort auf Abgründe: Zehntausende tauschten sich in den Chats über Methoden aus, um Frauen zu betäuben und sich anschliessend an ihnen zu vergehen. Einige Nutzer boten ihre Freundinnen für andere zur Vergewaltigung an. Die beiden Journalistinnen des NDR merkten schnell: Der Fall Pélicot ist kein Einzelfall - bei weitem nicht. In diesem Werkstattgespräch geben sie nicht nur praktische Recherchetipps, sondern erzählen auch, wie sie mit der psychischen Belastung umgegangen sind.
Mit: Isabelle Beer (norddeutscher Rundfunk & Strg_F) und Isabel Ströh (norddeutscher Rundfunk & Strg_F)
Der lange Schatten des Fall Pélicot - Recherche zu “chemischer Unterwerfung” auf Telegram
Im Herbst 2024 startete der Strafprozess gegen den Ex-Ehemann und Vergewaltiger von Gisèle Pélicot in Avignon. Und plötzlich redete die ganze Welt über sexualisierte Gewalt und chemische Unterwerfung. Isabelle Beer und Isabel Ströh beobachteten zu diesem Zeitpunkt schon seit Monaten Vergewaltiger-Netzwerken auf Telegram. Sie stiessen dort auf Abgründe: Zehntausende tauschten sich in den Chats über Methoden aus, um Frauen zu betäuben und sich anschliessend an ihnen zu vergehen. Einige Nutzer boten ihre Freundinnen für andere zur Vergewaltigung an. Die beiden Journalistinnen des NDR merkten schnell: Der Fall Pélicot ist kein Einzelfall - bei weitem nicht. In diesem Werkstattgespräch geben sie nicht nur praktische Recherchetipps, sondern erzählen auch, wie sie mit der psychischen Belastung umgegangen sind.
Mit: Isabelle Beer (norddeutscher Rundfunk & Strg_F) und Isabel Ströh (norddeutscher Rundfunk & Strg_F)
Der lange Schatten des Fall Pélicot - Recherche zu “chemischer Unterwerfung” auf Telegram
Im Herbst 2024 startete der Strafprozess gegen den Ex-Ehemann und Vergewaltiger von Gisèle Pélicot in Avignon. Und plötzlich redete die ganze Welt über sexualisierte Gewalt und chemische Unterwerfung. Isabelle Beer und Isabel Ströh beobachteten zu diesem Zeitpunkt schon seit Monaten Vergewaltiger-Netzwerken auf Telegram. Sie stiessen dort auf Abgründe: Zehntausende tauschten sich in den Chats über Methoden aus, um Frauen zu betäuben und sich anschliessend an ihnen zu vergehen. Einige Nutzer boten ihre Freundinnen für andere zur Vergewaltigung an. Die beiden Journalistinnen des NDR merkten schnell: Der Fall Pélicot ist kein Einzelfall - bei weitem nicht. In diesem Werkstattgespräch geben sie nicht nur praktische Recherchetipps, sondern erzählen auch, wie sie mit der psychischen Belastung umgegangen sind.
Mit: Isabelle Beer (norddeutscher Rundfunk & Strg_F) und Isabel Ströh (norddeutscher Rundfunk & Strg_F)
Der lange Schatten des Fall Pélicot - Recherche zu “chemischer Unterwerfung” auf Telegram
Im Herbst 2024 startete der Strafprozess gegen den Ex-Ehemann und Vergewaltiger von Gisèle Pélicot in Avignon. Und plötzlich redete die ganze Welt über sexualisierte Gewalt und chemische Unterwerfung. Isabelle Beer und Isabel Ströh beobachteten zu diesem Zeitpunkt schon seit Monaten Vergewaltiger-Netzwerken auf Telegram. Sie stiessen dort auf Abgründe: Zehntausende tauschten sich in den Chats über Methoden aus, um Frauen zu betäuben und sich anschliessend an ihnen zu vergehen. Einige Nutzer boten ihre Freundinnen für andere zur Vergewaltigung an. Die beiden Journalistinnen des NDR merkten schnell: Der Fall Pélicot ist kein Einzelfall - bei weitem nicht. In diesem Werkstattgespräch geben sie nicht nur praktische Recherchetipps, sondern erzählen auch, wie sie mit der psychischen Belastung umgegangen sind.
Mit: Isabelle Beer (norddeutscher Rundfunk & Strg_F) und Isabel Ströh (norddeutscher Rundfunk & Strg_F)
Der lange Schatten des Fall Pélicot - Recherche zu “chemischer Unterwerfung” auf Telegram
Im Herbst 2024 startete der Strafprozess gegen den Ex-Ehemann und Vergewaltiger von Gisèle Pélicot in Avignon. Und plötzlich redete die ganze Welt über sexualisierte Gewalt und chemische Unterwerfung. Isabelle Beer und Isabel Ströh beobachteten zu diesem Zeitpunkt schon seit Monaten Vergewaltiger-Netzwerken auf Telegram. Sie stiessen dort auf Abgründe: Zehntausende tauschten sich in den Chats über Methoden aus, um Frauen zu betäuben und sich anschliessend an ihnen zu vergehen. Einige Nutzer boten ihre Freundinnen für andere zur Vergewaltigung an. Die beiden Journalistinnen des NDR merkten schnell: Der Fall Pélicot ist kein Einzelfall - bei weitem nicht. In diesem Werkstattgespräch geben sie nicht nur praktische Recherchetipps, sondern erzählen auch, wie sie mit der psychischen Belastung umgegangen sind.
Mit: Isabelle Beer (norddeutscher Rundfunk & Strg_F) und Isabel Ströh (norddeutscher Rundfunk & Strg_F)
Covering Trump – Zwischen Chronistenpflicht und Kontrollverlust
Wie berichtet man über einen Präsidenten, der die Presse zur „Feindin des Volkes“ erklärt? Tritt Donald Trump auf die Bühne, finden sich Journalist:innen irgendwo zwischen Fakten, Framing und Frontalangriffen wieder. Wie navigiert man in einem Klima der Polarisierung und Desinformation? Und was lernen wir daraus für die politische Berichterstattung?
Mit: Fabian Fellmann (US-Korrespondent des Tages-Anzeigers) und Peter Hossli (Buchautor und langjähriger USA-Beobachter)
Moderation: Ralph Steiner (watson)
Covering Trump – Zwischen Chronistenpflicht und Kontrollverlust
Wie berichtet man über einen Präsidenten, der die Presse zur „Feindin des Volkes“ erklärt? Tritt Donald Trump auf die Bühne, finden sich Journalist:innen irgendwo zwischen Fakten, Framing und Frontalangriffen wieder. Wie navigiert man in einem Klima der Polarisierung und Desinformation? Und was lernen wir daraus für die politische Berichterstattung?
Mit: Fabian Fellmann (US-Korrespondent des Tages-Anzeigers) und Peter Hossli (Buchautor und langjähriger USA-Beobachter)
Moderation: Ralph Steiner (watson)
Covering Trump – Zwischen Chronistenpflicht und Kontrollverlust
Wie berichtet man über einen Präsidenten, der die Presse zur „Feindin des Volkes“ erklärt? Tritt Donald Trump auf die Bühne, finden sich Journalist:innen irgendwo zwischen Fakten, Framing und Frontalangriffen wieder. Wie navigiert man in einem Klima der Polarisierung und Desinformation? Und was lernen wir daraus für die politische Berichterstattung?
Mit: Fabian Fellmann (US-Korrespondent des Tages-Anzeigers) und Peter Hossli (Buchautor und langjähriger USA-Beobachter)
Moderation: Ralph Steiner (watson)
Covering Trump – Zwischen Chronistenpflicht und Kontrollverlust
Wie berichtet man über einen Präsidenten, der die Presse zur „Feindin des Volkes“ erklärt? Tritt Donald Trump auf die Bühne, finden sich Journalist:innen irgendwo zwischen Fakten, Framing und Frontalangriffen wieder. Wie navigiert man in einem Klima der Polarisierung und Desinformation? Und was lernen wir daraus für die politische Berichterstattung?
Mit: Fabian Fellmann (US-Korrespondent des Tages-Anzeigers) und Peter Hossli (Buchautor und langjähriger USA-Beobachter)
Moderation: Ralph Steiner (watson)
Covering Trump – Zwischen Chronistenpflicht und Kontrollverlust
Wie berichtet man über einen Präsidenten, der die Presse zur „Feindin des Volkes“ erklärt? Tritt Donald Trump auf die Bühne, finden sich Journalist:innen irgendwo zwischen Fakten, Framing und Frontalangriffen wieder. Wie navigiert man in einem Klima der Polarisierung und Desinformation? Und was lernen wir daraus für die politische Berichterstattung?
Mit: Fabian Fellmann (US-Korrespondent des Tages-Anzeigers) und Peter Hossli (Buchautor und langjähriger USA-Beobachter)
Moderation: Ralph Steiner (watson)
Cartoons gegen die Bleiwüste – 2025 in Bildern mit Ruedi Widmer und Regina Vetter
Ruedi Widmer ist eine Ikone der Schweizer Cartoon-Szene und ein Connaisseur absurden Humors. Höchste Zeit also für einen Dreivierteljahresrückblick in Cartoons. Was war wieder los, Herr Widmer, und was haben Sie zur Weltraumreise von Katy Perry gezeichnet? Regina Vetter ist Karikaturistin und kennt als Gründerin der Plattform «Petarde» die Schweizer Cartoon-Szene wie ihre Bleistiftbox Während wir in dieser Veranstaltung durch heite Beispiele scrollen, sprechen wir über das Handwerk der politischen Satire, den aktuellen Stand der Lustigkeit und dünne Luft für Cartoonist:innen auf Schweizer Redaktionen. Am Ende schlüpfen Widmer und Vetter für uns ins Gewand der knallharten Kritiker:innen und schauen auf eine Nachbardisziplin drüben bei Instagram: Memes. Droht da die Wachablösung? Es wird hoffentlich lustig. Fragen und Getränke im und aus dem Publikum sind willkommen.
Mit: Ruedi Widmer (Illustrator und Cartoonist) und Regina Vetter (Illustratorin)
Moderation: Daniel Faulhaber (Beobachter)
Cartoons gegen die Bleiwüste – 2025 in Bildern mit Ruedi Widmer und Regina Vetter
Ruedi Widmer ist eine Ikone der Schweizer Cartoon-Szene und ein Connaisseur absurden Humors. Höchste Zeit also für einen Dreivierteljahresrückblick in Cartoons. Was war wieder los, Herr Widmer, und was haben Sie zur Weltraumreise von Katy Perry gezeichnet? Regina Vetter ist Karikaturistin und kennt als Gründerin der Plattform «Petarde» die Schweizer Cartoon-Szene wie ihre Bleistiftbox Während wir in dieser Veranstaltung durch heite Beispiele scrollen, sprechen wir über das Handwerk der politischen Satire, den aktuellen Stand der Lustigkeit und dünne Luft für Cartoonist:innen auf Schweizer Redaktionen. Am Ende schlüpfen Widmer und Vetter für uns ins Gewand der knallharten Kritiker:innen und schauen auf eine Nachbardisziplin drüben bei Instagram: Memes. Droht da die Wachablösung? Es wird hoffentlich lustig. Fragen und Getränke im und aus dem Publikum sind willkommen.
Mit: Ruedi Widmer (Illustrator und Cartoonist) und Regina Vetter (Illustratorin)
Moderation: Daniel Faulhaber (Beobachter)
Cartoons gegen die Bleiwüste – 2025 in Bildern mit Ruedi Widmer und Regina Vetter
Ruedi Widmer ist eine Ikone der Schweizer Cartoon-Szene und ein Connaisseur absurden Humors. Höchste Zeit also für einen Dreivierteljahresrückblick in Cartoons. Was war wieder los, Herr Widmer, und was haben Sie zur Weltraumreise von Katy Perry gezeichnet? Regina Vetter ist Karikaturistin und kennt als Gründerin der Plattform «Petarde» die Schweizer Cartoon-Szene wie ihre Bleistiftbox Während wir in dieser Veranstaltung durch heite Beispiele scrollen, sprechen wir über das Handwerk der politischen Satire, den aktuellen Stand der Lustigkeit und dünne Luft für Cartoonist:innen auf Schweizer Redaktionen. Am Ende schlüpfen Widmer und Vetter für uns ins Gewand der knallharten Kritiker:innen und schauen auf eine Nachbardisziplin drüben bei Instagram: Memes. Droht da die Wachablösung? Es wird hoffentlich lustig. Fragen und Getränke im und aus dem Publikum sind willkommen.
Mit: Ruedi Widmer (Illustrator und Cartoonist) und Regina Vetter (Illustratorin)
Moderation: Daniel Faulhaber (Beobachter)
Cartoons gegen die Bleiwüste – 2025 in Bildern mit Ruedi Widmer und Regina Vetter
Ruedi Widmer ist eine Ikone der Schweizer Cartoon-Szene und ein Connaisseur absurden Humors. Höchste Zeit also für einen Dreivierteljahresrückblick in Cartoons. Was war wieder los, Herr Widmer, und was haben Sie zur Weltraumreise von Katy Perry gezeichnet? Regina Vetter ist Karikaturistin und kennt als Gründerin der Plattform «Petarde» die Schweizer Cartoon-Szene wie ihre Bleistiftbox Während wir in dieser Veranstaltung durch heite Beispiele scrollen, sprechen wir über das Handwerk der politischen Satire, den aktuellen Stand der Lustigkeit und dünne Luft für Cartoonist:innen auf Schweizer Redaktionen. Am Ende schlüpfen Widmer und Vetter für uns ins Gewand der knallharten Kritiker:innen und schauen auf eine Nachbardisziplin drüben bei Instagram: Memes. Droht da die Wachablösung? Es wird hoffentlich lustig. Fragen und Getränke im und aus dem Publikum sind willkommen.
Mit: Ruedi Widmer (Illustrator und Cartoonist) und Regina Vetter (Illustratorin)
Moderation: Daniel Faulhaber (Beobachter)
Cartoons gegen die Bleiwüste – 2025 in Bildern mit Ruedi Widmer und Regina Vetter
Ruedi Widmer ist eine Ikone der Schweizer Cartoon-Szene und ein Connaisseur absurden Humors. Höchste Zeit also für einen Dreivierteljahresrückblick in Cartoons. Was war wieder los, Herr Widmer, und was haben Sie zur Weltraumreise von Katy Perry gezeichnet? Regina Vetter ist Karikaturistin und kennt als Gründerin der Plattform «Petarde» die Schweizer Cartoon-Szene wie ihre Bleistiftbox Während wir in dieser Veranstaltung durch heite Beispiele scrollen, sprechen wir über das Handwerk der politischen Satire, den aktuellen Stand der Lustigkeit und dünne Luft für Cartoonist:innen auf Schweizer Redaktionen. Am Ende schlüpfen Widmer und Vetter für uns ins Gewand der knallharten Kritiker:innen und schauen auf eine Nachbardisziplin drüben bei Instagram: Memes. Droht da die Wachablösung? Es wird hoffentlich lustig. Fragen und Getränke im und aus dem Publikum sind willkommen.
Mit: Ruedi Widmer (Illustrator und Cartoonist) und Regina Vetter (Illustratorin)
Moderation: Daniel Faulhaber (Beobachter)
Why me? Wie man über das verpönte "Ich" schreibt
Journalist:innen gehen in die Welt, um die guten Geschichten zu suchen. Aber was, wenn wir eine Geschichte bei uns selbst finden?
Sich als Journalist:in zur:zum Protagonist:in des eigenen Textes zu machen, ist eine der meistdiskutierten Praktiken im Job. Es gibt so viele interessante Dinge zu erzählen - warum ausgerechnet über das so verpönte «Ich» schreiben?
Theresa Hein schreibt bei weitem nicht nur, aber immer wieder über ihr Leben. Zum Beispiel darüber, warum ihr Mann im Urlaub nervt. Über ihre jahrelange Schlaflosigkeit. Oder über die Frage, ab wann man eigentlich erwachsen ist.
Im Workshop erzählt sie, warum sie das tut, wann sie zweifelt, und wann sie es lässt. Sie teilt Tipps und Tricks, wie aus der eigenen Geschichte eine gelungener journalistischer Text wird. Wie man mit Kolleg:innen umgeht, die behaupten, man habe ein Ego-Problem und warum ein „Essay“ zu den schwierigsten Disziplinen überhaupt gehören kann (okay, ausser es geht um Urlaub).
Der Workshop ist auf 15 Teilnehmer:innen beschränkt. Wenn du dabei sein willst, schicke bitte einen persönlichen Text oder eine noch unausgereifte Textidee an anmeldung@reporter-forum.ch. Über beides können wir sprechen und gemeinsam versuchen, Knoten in Köpfen zu lösen. First come, first serve.
Mit: Theresa Hein (Süddeutsche Zeitung Magazin)
Moderation: Ronja Beck (Republik)
Why me? Wie man über das verpönte "Ich" schreibt
Journalist:innen gehen in die Welt, um die guten Geschichten zu suchen. Aber was, wenn wir eine Geschichte bei uns selbst finden?
Sich als Journalist:in zur:zum Protagonist:in des eigenen Textes zu machen, ist eine der meistdiskutierten Praktiken im Job. Es gibt so viele interessante Dinge zu erzählen - warum ausgerechnet über das so verpönte «Ich» schreiben?
Theresa Hein schreibt bei weitem nicht nur, aber immer wieder über ihr Leben. Zum Beispiel darüber, warum ihr Mann im Urlaub nervt. Über ihre jahrelange Schlaflosigkeit. Oder über die Frage, ab wann man eigentlich erwachsen ist.
Im Workshop erzählt sie, warum sie das tut, wann sie zweifelt, und wann sie es lässt. Sie teilt Tipps und Tricks, wie aus der eigenen Geschichte eine gelungener journalistischer Text wird. Wie man mit Kolleg:innen umgeht, die behaupten, man habe ein Ego-Problem und warum ein „Essay“ zu den schwierigsten Disziplinen überhaupt gehören kann (okay, ausser es geht um Urlaub).
Der Workshop ist auf 15 Teilnehmer:innen beschränkt. Wenn du dabei sein willst, schicke bitte einen persönlichen Text oder eine noch unausgereifte Textidee an anmeldung@reporter-forum.ch. Über beides können wir sprechen und gemeinsam versuchen, Knoten in Köpfen zu lösen. First come, first serve.
Mit: Theresa Hein (Süddeutsche Zeitung Magazin)
Moderation: Ronja Beck (Republik)
Why me? Wie man über das verpönte "Ich" schreibt
Journalist:innen gehen in die Welt, um die guten Geschichten zu suchen. Aber was, wenn wir eine Geschichte bei uns selbst finden?
Sich als Journalist:in zur:zum Protagonist:in des eigenen Textes zu machen, ist eine der meistdiskutierten Praktiken im Job. Es gibt so viele interessante Dinge zu erzählen - warum ausgerechnet über das so verpönte «Ich» schreiben?
Theresa Hein schreibt bei weitem nicht nur, aber immer wieder über ihr Leben. Zum Beispiel darüber, warum ihr Mann im Urlaub nervt. Über ihre jahrelange Schlaflosigkeit. Oder über die Frage, ab wann man eigentlich erwachsen ist.
Im Workshop erzählt sie, warum sie das tut, wann sie zweifelt, und wann sie es lässt. Sie teilt Tipps und Tricks, wie aus der eigenen Geschichte eine gelungener journalistischer Text wird. Wie man mit Kolleg:innen umgeht, die behaupten, man habe ein Ego-Problem und warum ein „Essay“ zu den schwierigsten Disziplinen überhaupt gehören kann (okay, ausser es geht um Urlaub).
Der Workshop ist auf 15 Teilnehmer:innen beschränkt. Wenn du dabei sein willst, schicke bitte einen persönlichen Text oder eine noch unausgereifte Textidee an anmeldung@reporter-forum.ch. Über beides können wir sprechen und gemeinsam versuchen, Knoten in Köpfen zu lösen. First come, first serve.
Mit: Theresa Hein (Süddeutsche Zeitung Magazin)
Moderation: Ronja Beck (Republik)
Why me? Wie man über das verpönte "Ich" schreibt
Journalist:innen gehen in die Welt, um die guten Geschichten zu suchen. Aber was, wenn wir eine Geschichte bei uns selbst finden?
Sich als Journalist:in zur:zum Protagonist:in des eigenen Textes zu machen, ist eine der meistdiskutierten Praktiken im Job. Es gibt so viele interessante Dinge zu erzählen - warum ausgerechnet über das so verpönte «Ich» schreiben?
Theresa Hein schreibt bei weitem nicht nur, aber immer wieder über ihr Leben. Zum Beispiel darüber, warum ihr Mann im Urlaub nervt. Über ihre jahrelange Schlaflosigkeit. Oder über die Frage, ab wann man eigentlich erwachsen ist.
Im Workshop erzählt sie, warum sie das tut, wann sie zweifelt, und wann sie es lässt. Sie teilt Tipps und Tricks, wie aus der eigenen Geschichte eine gelungener journalistischer Text wird. Wie man mit Kolleg:innen umgeht, die behaupten, man habe ein Ego-Problem und warum ein „Essay“ zu den schwierigsten Disziplinen überhaupt gehören kann (okay, ausser es geht um Urlaub).
Der Workshop ist auf 15 Teilnehmer:innen beschränkt. Wenn du dabei sein willst, schicke bitte einen persönlichen Text oder eine noch unausgereifte Textidee an anmeldung@reporter-forum.ch. Über beides können wir sprechen und gemeinsam versuchen, Knoten in Köpfen zu lösen. First come, first serve.
Mit: Theresa Hein (Süddeutsche Zeitung Magazin)
Moderation: Ronja Beck (Republik)
Why me? Wie man über das verpönte "Ich" schreibt
Journalist:innen gehen in die Welt, um die guten Geschichten zu suchen. Aber was, wenn wir eine Geschichte bei uns selbst finden?
Sich als Journalist:in zur:zum Protagonist:in des eigenen Textes zu machen, ist eine der meistdiskutierten Praktiken im Job. Es gibt so viele interessante Dinge zu erzählen - warum ausgerechnet über das so verpönte «Ich» schreiben?
Theresa Hein schreibt bei weitem nicht nur, aber immer wieder über ihr Leben. Zum Beispiel darüber, warum ihr Mann im Urlaub nervt. Über ihre jahrelange Schlaflosigkeit. Oder über die Frage, ab wann man eigentlich erwachsen ist.
Im Workshop erzählt sie, warum sie das tut, wann sie zweifelt, und wann sie es lässt. Sie teilt Tipps und Tricks, wie aus der eigenen Geschichte eine gelungener journalistischer Text wird. Wie man mit Kolleg:innen umgeht, die behaupten, man habe ein Ego-Problem und warum ein „Essay“ zu den schwierigsten Disziplinen überhaupt gehören kann (okay, ausser es geht um Urlaub).
Der Workshop ist auf 15 Teilnehmer:innen beschränkt. Wenn du dabei sein willst, schicke bitte einen persönlichen Text oder eine noch unausgereifte Textidee an anmeldung@reporter-forum.ch. Über beides können wir sprechen und gemeinsam versuchen, Knoten in Köpfen zu lösen. First come, first serve.
Mit: Theresa Hein (Süddeutsche Zeitung Magazin)
Moderation: Ronja Beck (Republik)
Apéro im Volkshaus
Apéro im Volkshaus
Apéro im Volkshaus
Zum zehnjährigen Jubiläum vom Reporter:innen-Forum laden wir euch alle zu einem Apéro Riche im Volkshaus ein.
Ort: Blauer Saal
Zum zehnjährigen Jubiläum vom Reporter:innen-Forum laden wir euch alle zu einem Apéro Riche im Volkshaus ein.
Ort: Blauer Saal
Zum zehnjährigen Jubiläum vom Reporter:innen-Forum laden wir euch alle zu einem Apéro-Riche im Volkshaus ein.
Ort: Blauer Saal
Unterstützt von ...
Unterstützt von ...
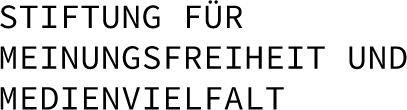





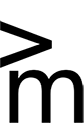




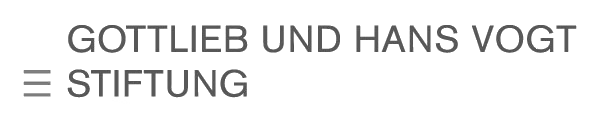



© Reporter:innen-Forum Schweiz 2015-2023 – Impressum – Kontakt: info[ätt]reporter-forum.ch ⧇ Twitter ⧇ Facebook ⧇ Instagram
© Reporter-Forum Schweiz 2015-2021 – Impressum – Kontakt: info[ätt]reporter-forum.ch ⧇ Twitter ⧇ Facebook ⧇ Instagram
© Reporter-Forum Schweiz 2015-2021 – Impressum – Kontakt: info[ätt]reporter-forum.ch ⧇ Twitter ⧇ Facebook ⧇ Instagram